Über das Wesen unseres Zeitalters
Lois Lammerhuber: Es gibt nicht wenige, die meinen, Fotografie sei die wichtigste Disziplin, um dem Wesen unseres Zeitalters auf die Spur zu kommen. Sie haben viele Jahre verantwortlich beim CMS Experiment am CERN gearbeitet, waren massgeblich an der Entdeckung des Higgs-Teilchens und damit an der Vervollständigung des Standardmodells der Elementarteilchenphysik beteiligt. Eine Forschung, die ungeheure Datenmengen produziert, die ohne bildgebende Verfahren nicht «lesbar» wären. Was bedeuten Bilder, was bedeutet Fotografie für Sie?
Günther Dissertori: Es ist in der Tat interessant, dass Bilder in der Spitzenforschung wichtig sind, um hoch Abstraktes verstehen zu können. Sie reichen nicht immer aus, um den gesamten Inhalt irgendeiner wissenschaftlichen Tatsache, irgendeines Kontextes darzustellen, aber sie helfen sehr oft, von einem gewissen Abstraktionslevel auf ein anderes Level zu gehen, mit dem anscheinend das menschliche Gehirn gut umgehen kann.
Diese ungeheuren Datenmengen, die am CERN produziert werden – das unterstelle ich jetzt – sind mit Wissen alleine nicht mehr zu erfassen, oder?
Genau. Aber die tatsächlichen Analysen, die tatsächlichen Ergebnisse, die publiziert werden – am Ende sind es im banalsten Sinne Zahlen, also Messwerte – die werden nicht mehr gewonnen, in dem man Bilder anschaut. Man müsste Milliarden Bilder anschauen. Die Sechziger- und Siebzigerjahre waren eine Zeit, in der man diese Bilder angeschaut hat und so die Analyse gemacht hat. Heute werden Computeralgorithmen verwendet. Um solche Algorithmen zu entwickeln, helfen Bilder. Entweder zuerst, um die Idee zu definieren, wie der Algorithmus vielleicht vorgehen sollte, oder nachträglich, wenn man einen Algorithmus hat, um zu überprüfen, ob der Algorithmus macht, was er machen sollte. Bilder helfen als Referenz bei hochkomplexen Überlegungen – in der Biologie, in der Chemie, bei der Darstellung von Molekülstrukturen, der Darstellung von Proteinen. Es gibt viele, viele andere Beispiele. Bilder sind immer noch wichtig, um ein tieferes oder auch intuitives Verständnis von Zusammenhängen zu erlangen.
Also schon eine frühe oder eine Vorläuferform von dem, was jetzt unter Künstlicher Intelligenz (KI) populär geworden ist?
KI ist ein grosses, grosses, grosses Thema. Ich weiss nicht, ob man es so einfach verbinden kann. KI wird auch auf gewisse fixe Daten trainiert. Vielleicht könnte man es so sagen: Ich trainiere etwas durch einzelne Bilder, und dann lasse ich es algorithmisch laufen. Ja, ich sehe den Zusammenhang.
Das heisst, ich habe gestern Nacht beim Ordnen meiner Fragen durchaus richtig antizipiert, denn ich habe mir als Stichwort «Goethe» aufgeschrieben, der sich gefragt hat: «Sehe ich nur, was ich weiss?» Wie erleben Sie das in der modernen Wissenschaft, die kaum mehr ohne Computersimulationen Thesen entwickeln kann, und die häufig und intensiv natürlich mit Grafiken, ist gleich Bildern, arbeiten muss?
Für mich ist einer der faszinierendsten Aspekte der modernen Wissenschaft, oder sagen wir einfach, der Errungenschaften der Menschheit und der menschlichen Intelligenz, dass wir es geschafft haben, Gesetze zum Verständnis der Natur in Bereichen aufzustellen, die unseren Sinnen völlig unzugänglich sind. Das ist eine unglaubliche intellektuelle Leistung. Das heisst, wir brauchen zwar immer wieder unsere Sinne zur Unterstützung, aber letztendlich sind wir weit darüber hinausgegangen. Dass dies möglich ist, finde ich philosophisch hochinteressant. Ich denke zum Beispiel an die Quantenphysik. Dass es ein Faktum ist, plötzlich eine Welt beschreiben zu können, die beliebig weit weg von unserer Alltagserfahrung ist, und wir es geschafft haben, eine Sprache dafür zu entwickeln, die dann wiederum auf die Natur passt, weil sie extrem gute Vorhersagen möglich macht. Das ist ein Teil jenes Gedankens, der für mich zurzeit am faszinierendsten ist und mich am meisten beschäftigt: Der Mensch hat begonnen, das Universum zu studieren. Als Teilchenphysiker bin ich Reduktionist. Das heisst, man versucht, das Ganze auf einfache Prinzipien zu reduzieren. Für mich ist das Universum ein System von Teilchen und Wechselwirkungen. Und der Mensch ist ein Teil dieses Systems. Das heisst weiter: Durch uns, also durch einen Teil des Systems, erkennt sich das Universum gewissermassen selbst. Dass sich dieses System in einen Zustand entwickelt hat, der so fortgeschritten ist, dass es anfängt sich selbst zu untersuchen, das ist für mich der grossartigste Gedanke überhaupt. Und dann frage ich mich: Ist es vielleicht das tiefste Gesetz, dass die Natur – und wir Menschen als Teil davon – vielleicht sogar gezwungen sind, sich selbst zu erkennen? Wir Menschen sind ja der Beweis, dass diese Möglichkeit zumindest besteht. Das sind so meine privaten, philosophischen Hirngespinste.
Dieser Gedanke hat einen extrem hohen Erkenntnisanspruch. Wahrscheinlich sind nur wenige Menschen fähig so zu denken. Ich habe einmal miterlebt, wie ein russischer Mathematiker am Institut für Quantenphysik bei Professor Zeilinger in Wien verworfene mathematische Theoreme auf ihre Brauchbarkeit für die Aussagen, die dort untersucht werden, analysierte. Dieser Vormittag war für mich ein persönlicher intellektueller Abgrund. Denn ich habe nicht ein Wort verstanden, während die jungen Wissenschafter:innen, die da im Alter von 20+ zugehört haben, sich auf die Schenkel geklopft haben und das lustig und herausfordernd fanden oder applaudiert haben. Diese Erinnerung passt irgendwie ganz gut zu etwas, das mich immer interessiert hat: Der menschliche Faktor. Sie waren im Juli des Sommer 2012 dabei, als die ganze Welt nach Genf geblickt hat, wo die Entdeckung des Higgs-Teilchens bekannt gegeben wurde. Ein gutes Jahr später haben Peter Higgs und François Englert den Nobelpreis für Physik bekommen, da diese Entdeckung aufgrund ihrer Theorien möglich wurde. Und andere Beteiligte, wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des CERN, sind leer ausgegangen. Also auch Sie. Wie ist es Ihnen damit gegangen?
Ich habe damit überhaupt kein Problem gehabt. Vor allem weil mir klar war, dass ich bei dieser Entdeckung bei weitem nicht der Wichtigste war, sondern das Wichtigste war eben die Gesamtheit der Forscherinnen und Forscher. Allerdings hätte ich es auch nicht schlecht gefunden, wenn man beim Nobelpreis-Komitee eine Änderung der Regeln erwogen und gesagt hätte, man kann auch eine Institution auszeichnen. Dann hätte das CERN den Preis erhalten sollen. Hätte mich gefreut. Es gibt aber auch eine problematische Komponente dabei, denn bei der Nobelpreisverleihung würde dann eine Person diese Institution vertreten. Das hätte mich wieder gestört, denn die Person rückt dann in der Öffentlichkeit ins Zentrum, und dann wird das gleichgesetzt, und das wäre wieder falsch. Es ist ein fundamentales Dilemma im Kontext dieser Art von Forschung. Ich habe mich gefreut, dass diese Entdeckung so schnell zum Nobelpreis geführt hat. Ich habe mich für die Theoretikerinnen und Theoretiker gefreut, die ihn gekriegt haben, und dass ich miterleben konnte, dass der Preis mit der Forschung zu tun hat, in die ich involviert war. In diesem Sinn war das alles positiv. Wäre ich zu dem Zeitpunkt Generaldirektor des CERN gewesen, hätte ich vielleicht anders gedacht. Die Institution hätte es sicher verdient. Denn es ist bemerkenswert, dass es eine Gruppe von europäischen Ländern geschafft hat, eine Institution aufzustellen, die so aussergewöhnliche Ergebnisse generiert. Das müsste man eigentlich auszeichnen, so wie es beim Friedens-Nobelpreis ab und zu passiert.
Nachdem wir schon über bildgebende Verfahren geredet haben, möchte ich Ihnen jetzt endlich ein Bild zeigen. Es zeigt auf sehr grafische Weise den Nordatlantik, der unter einer noch nie dagewesenen Wasseroberflächen-Hitzewelle leidet. Zumindest ist es die schlimmste seit 1850, also seit es Aufzeichnungen gibt. Was können Sie als erfahrener «Bild-Ausleser» in diesem Bild sehen?
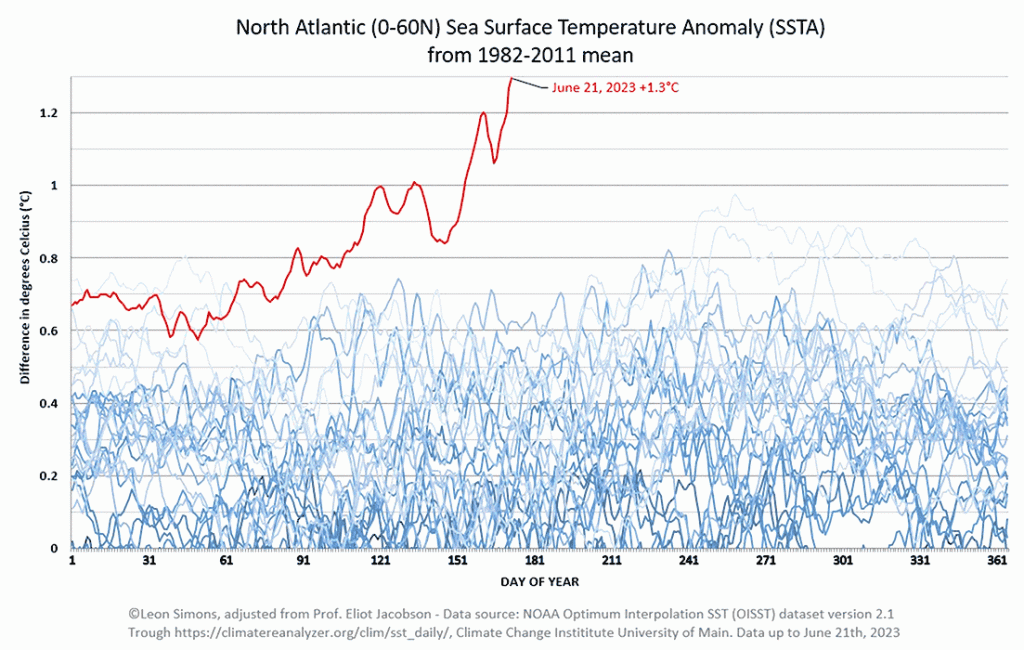
Eine vermutlich statistisch signifikante Abweichung, um es wissenschaftlich vorsichtig auszudrücken. Die blauen Linien bezeichnen die Jahre 1982 bis 2011. Warum sind 2012 bis 2022 nicht drauf? Das wäre noch interessant zu wissen. Aber Wissenschafter haben immer gleich neue Fragen auf Fragen. Die Grafik ist beunruhigend. Wenn ich so etwas sehe, kommt mir sofort der Gedanke: What else do you need? Was braucht es noch an Evidenz, um alle zu überzeugen, dass es den vom Menschen gemachten Klimawandel gibt? Und dass er ein riesiges Problem ist. Offenbar lernt der Mensch nur aus Disruption – also Zerstörung.
Ich habe mich natürlich gefragt, warum diese Grafik nicht auf der Titelseite jeder Tageszeitung erscheint. Ich meine, wirklich jeder. Nun sind wir mit dieser Frage nicht nur mitten im Nordatlantik gelandet, sondern auch genau genommen inmitten mehreren Sustainable Development Goals, und zwar SDG 13: Massnahmen zum Klimaschutz, SDG 14: Leben unter Wasser und wahrscheinlich auch SDG 2: Kein Hunger. Ich darf bei der Gelegenheit daran erinnern, dass 2021, während einer nicht annähernd so extremen Oberflächenwasser-Hitzewelle vor Kanadas Westküste geschätzt eine Milliarde Meeresfrüchte geradezu zu Tode gekocht wurden. Wie kommt es, dass ein so enthusiastischer Physiker wie Sie es sind, sich für die SDGs fast noch mehr begeistert?
Ich möchte das präzisieren, denn künftige Historikerinnen und Historiker fänden kaum Belege dafür, dass ich bisher besonders viel zur Unterstützung der SDGs beigetragen hätte. Es wäre also falsch, mich als glühenden öffentlichen SDG-Propagator darzustellen.
Tatsache ist, die Welt entwickelt sich in vielerlei Hinsicht in eine gefährliche Richtung. Die meisten Menschen sind sich bewusst, dass es jetzt ganz grosse Herausforderungen zu bewältigen gibt. Ich sage jetzt bewusst nicht alle – denn das müsste man wahrscheinlich wieder wissenschaftlich belegen … Also ich improvisiere jetzt, okay? Ich rede jetzt, um zu hören, was ich denke.
Viele dieser Herausforderungen kann man nur dann unter Kontrolle kriegen, indem menschliches Verhalten geändert wird. Jetzt haben wir ein Problem: Menschliches Verhalten ist anscheinend sehr schwierig zu ändern, vielleicht überhaupt nur durch Disruption oder über lange Zeitskalen. Aber wir haben keine Zeit mehr. Also was kann man dann machen? Man kann auf Technologien setzen. Dann kommen Bildungs- und Forschungseinrichtungen ins Spiel, die einerseits die Aufgabe haben, Bewusstsein zu kreieren, Faktenwissen zu produzieren und vielleicht auch Lösungsansätze auf den Tisch zu legen, zumindest vorzuschlagen. Und da kommt unsere Verantwortung ins Spiel. Wir müssen dafür sorgen, dass möglichst viel Wissen und Bewusstsein für diese Problematik generiert wird, und dass dieses vor allem in den Köpfen unserer jungen Leute verankert wird. Inzwischen ist das vielleicht etwas leichter geworden, weil die Probleme derart präsent sind. Neue Erkenntnisse kreieren, Fakten produzieren und interpretieren – das, glaube ich, machen wir auch einigermassen erfolgreich. Wie man diese Fakten an die Gesellschaft heranträgt, das ist eine andere Diskussion. Schliesslich muss die Forschung auch Lösungsvorschläge machen. Daran arbeiten wir.
Vielleicht kann ich es so formulieren: Wenn Bildungsinstitutionen wie unsere nichts machen, wer dann? Und deswegen ist unsere, ist meine Verantwortung gross. Das ist aber nicht misszuverstehen mit einer Verantwortung, die erdrückt. Ich empfinde es eben nicht als erdrückende Verantwortung, eher als positive. Aber es ist eine grosse Verantwortung.
Das Problem liegt im menschlichen Verhalten. In letzter Zeit habe ich oft darüber nachgedacht – auch während der Pandemie. Ich bin zum Schluss gekommen, dass wir ein grundsätzliches Problem damit haben, dass der menschliche Verstand anscheinend nicht darauf «verdrahtet» ist, die Exponentialfunktion zu verstehen, wirklich intuitiv zu verstehen. Das können wir nicht.
Wir verstehen intuitiv lineare Änderungen. Das hat mit unseren Sinnen, vermutlich mit Evolution zu tun. Die Evolution hat bisher zu einem Menschen geführt, dessen Gehirn die Exponentialfunktion nicht intuitiv versteht. Und das ist der grosse Knackpunkt. Durch das Faktum, dass wir die Exponentialfunktion nicht intuitiv erfassen und eher linear denken, hinken wir vielen Entwicklungen systematisch hinterher. Und du kannst dich auf den Kopf stellen. Es wird einfach so bleiben. Die meisten Menschen werden nicht in der Lage sein, dieses systematische Problem zu überwinden. Während der Pandemie wurde das deutlich.
Und fast alle diese Phänomene, die uns die Probleme bereiten, sind exponentiell geartet. Wie wir das hinkriegen? Ich weiss es nicht, weil es eben vielleicht sogar ein Problem der Evolution ist. Aber wir werden natürlich alles versuchen, Lösungen zu finden und nicht in eine Frusthaltung zu treten und zu sagen, ja, am Ende können wir nicht viel tun. Mein Bild ist stets, dass wir zumindest die Samen säen können, in der Hoffnung, dass irgendwann einige dieser Samen aufgehen. Wenn wir jetzt aufhören, Samen zu produzieren und in die Welt auszustreuen, dann ist Hopfen und Malz verloren. Das ist mein Bild.
Wir leben mittlerweile in einer extrem dynamisierten Welt, auf der Erde gibt es fast neun Milliarden Menschen. Auf ihrem Schreibtisch liegt das Buch Einstein Forever. Sie sind in ein Gymnasium mit dem Namen Albert Einstein gegangen und Sie sind heute Rektor jener Hochschule, die immer noch eine Garderobe zu Ehren von Albert Einstein vorzeigen kann – was wunderschön ist. Aus diesem Anlass darf ich kurz Einstein zitieren. «Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern kann, der ist sozusagen tot und seine Augen erloschen.» Aus meiner Sicht passt dieser Anspruch in keinster Weise mehr in die Komplexität jener Welt, die sich mit den 17 nachhaltigen Entwicklungszielen, so etwas wie eine neue Weltordnung oder eine neue Roadmap für eine friedliche Weiterentwicklung unsere Welt erdacht hat. Für mich persönlich, ich sage das gerne, auch wenn es für das eine oder andere Ohr hoffärtig klingen mag, sind die SDGs wie neue Zehn Gebote 2.0, also ein Kodex, wie wir miteinander auskommen könnten.
Die Schlagworte sind für mich «Komplexität» und «die sich beschleunigt entwickelnde Welt». Und die Entwicklung hat eine Geschwindigkeit erreicht, mit der wir – wenn ich sage «wir» dann meine ich die Gesellschaft – weder intellektuell noch regulatorisch noch ressourcenmässig irgendwie hinterherkommen. Das ist das Problem. Die SDGs kann man daher auch als den vielleicht schon panikartigen Versuch verstehen, diese Beschleunigung zu bremsen oder diese Komplexität runterzukriegen. So fühlt es sich an. Die Zehn Gebote waren damals ja wohl auch ein Versuch, einem komplexen sozialen Gefüge eine Ordnung zu geben. Das war wahrscheinlich der Grund für die Zehn Gebote. Die beiden haben also schon Parallelen.
Faktum ist, dass den UN – also der Weltgemeinschaft – nur selten so grosse Würfe gelingen wie die SDGs. Ich halte die Formulierung der SDGs für extrem visionär und möglicherweise für den Rettungsanker für uns alle. Weil sie sich an der Wirklichkeit orientieren, weil sie den Ist-Zustand berücksichtigen, wie wir heute mit der Dynamik von Wirtschaftswachstum und mit der Sucht nach Wohlstand umgehen wollen. Auch mit der Notwendigkeit, und dessen ist sich jeder bewusst, dass es einen Ausgleich geben muss. Zwischen den Geschlechtern, zwischen Ethnien, Nord-Süd, Reich und Arm und so weiter. In die SDGs ist unglaublich viel eingeschrieben. Darf ich annehmen, dass auch Sie die SDGs als Aufforderung sehen, für ein neues Momentum, nein, für eine neue Ära, die sich jetzt entwickeln muss. Und zwar sehr schnell. Braucht die Wissenschaft daher einen neuen Ansatz zum Erkenntnisgewinn, um die Herausforderungen zu bestehen? Brauchen wir eine neue Wissenschaft?
Nein, ich würde nicht sagen, wir brauchen eine neue Wissenschaft oder eine neue Art des Erkenntnisgewinns. Aber in der Bildung und in der Ausbildung muss es jetzt einen Entwicklungsschritt geben hin zum systemischen Denken. Ich glaube, ein Grossteil der Probleme sind geprägt von grossen Abhängigkeiten und ein Grossteil der möglichen Lösungen haben mit systemischem Denken zu tun, die diese Abhängigkeiten reflektieren. Wenn man sich die Historie der letzten zweihundert oder dreihundert Jahre Wissenschaft anschaut, dann erkennt man die Tendenz, irgendwelche detaillierten Fragestellungen bis zum Gehtnichtmehr zu untersuchen. Ich glaube zwar, dass wir die Tiefe immer noch brauchen, denn all die genannten Probleme, die löst man nicht durch irgendein oberflächliches Bla Bla. Aber die Verknüpfung der Systeme zu einem grossen Ganzen zu erkennen und von Anfang an zu durchdenken – das wird entscheidend. Das müssen wir jetzt auch in der Lehre implementieren, davon bin ich überzeugt, das ist etwas, was ich fördern möchte.
Aber ändert das nicht die Rolle der Wissenschaft völlig? Hin zu eigentlich fast politischem Leadership – jenseits von nationalen, kontinentalen und auch weltpolitischen Ansprüchen? Die Politik kann diese Probleme offenbar ja nicht mehr lösen. Das haben wir während der Pandemie sehr gut gesehen, das geht sich nicht aus.
Da sind wir jetzt auf einer anderen, sehr interessanten und hochaktuellen Schiene in der Diskussion, nämlich: Was ist die Rolle der Wissenschaft bei der Lösung von gesellschaftlichen Problemen? Ich denke, die Rolle der Wissenschaft ist es, evidenzbasierte Szenarien auf den Tisch zu legen und zu sagen, das sind die Fakten. Und unter der und der Bedingung entwickelt sich etwas – entweder dorthin oder dorthin. Das sind die Szenarien, das sind die Konsequenzen. Und dann ist es die Rolle von Politik und/oder Gesellschaft, aus diesen Szenarien auszuwählen. Die Welt ist komplexer als aus der Sicht der Wissenschaft allein. Da sollte man sehr vorsichtig sein, sonst gehen wir in Richtung einer Diktatur der Intellektuellen. Aber wir müssen sicherstellen, dass der Dialog funktioniert. Das heisst, wir müssen erwarten dürfen, dass wir gehört werden, wenn wir mit neuen Szenarien kommen. Dass man miteinander reden kann. Dass wir unterstützen können bei der Auswahl der Lösungsoptionen. Aber die Entscheidung fällt dann die gesamte Gesellschaft. Die Wissenschaft ist nur ein Teil der Gesellschaft.
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich an ein Gespräch, das ich vor sehr langer Zeit mit Wolf D. Prix von der Architektengruppe Coop Himmelblau geführt habe, dabei sagte er: «Die Architektur ist dazu da, aus einer Unendlichkeit von Möglichkeiten eine auszuwählen – und diese zu vertreten.» Denn eigentlich muss auch die Wissenschaft dieses Privileg einfordern. Vor allem wenn ich an die Ansprüche erinnere, die die 17 SDGs in sich tragen. Nur die Kernbotschaften sind schon ein «Mont Blanc» an Anspruch: Die Würde des Menschen, den Planeten schützen, Wohlstand für alle, Frieden fördern, globale Partnerschaften ausbauen. Das alles liegt jetzt auch auf den Schultern der Wissenschaft. Das ist ein Aufruf zu wissensgetriebenem Leadership, das die Politik, zumindest meiner Meinung nach, nicht einlösen kann – und/oder auch nicht einlösen will. Das ist jedenfalls mein Eindruck.
Wahrscheinlich «nicht will», weil es sehr «menschelt.» Oder auch nicht mehr kann. Weil die Problematiken zu komplex geworden sind. Ich glaube, die meisten oder viele der Politikerinnen und Politiker sind schlichtweg überfordert, genauso wie fast alle von uns überfordert sind. Die Politik sieht sich gezwungen, Reglementarien aufzustellen. Und ja, auf den Schultern der Wissenschaft liegt diese Verantwortung auch. Ich möchte nochmal sagen – die Fakten und die Szenarien müssen auf den Tisch. Aber ich wäre vorsichtig! Mehr als das kann die Wissenschaft nicht leisten, solange sie sich wirklich nur Wissenschaft nennt.
Ich glaube, es wird uns de facto nichts anderes übrigbleiben, denn sonst füllt dieses Vakuum das «Silicon Valley» und wird früher oder später mit der Macht des Geldes ganze Länder dominieren können. Und natürlich hängt es aus meiner Sicht auch mit der herrschenden Informationspolitik zusammen, die in der Pandemie am Ende nicht funktioniert hat, weil sie «top down»war. Vielleicht ist das alles auch mit ein Grund, warum wir für dieses Festival zusammengefunden haben. Denn es ist genau das Gegenteil, nämlich «bottom up». Wie eingangs unseres Gespräches angemerkt, finden zwei Parteien einander, die zuerst einmal nicht zusammenzupassen scheinen. Wissenschaft und Fotografie. Und beginnen, etwas zu tun, was es so vorher nicht gab, nämlich die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu beschreiben. Grosse Fotografie ist in der Lage Bilder zu gestalten, deren Erzählkraft voll Empathie ist, die sich auf die Betrachter:innen überträgt – auf kürzestem Weg und über alle Sprachbarrieren hinweg vom Auge zum Herzen. Allerdings beschreiben diese Narrative die Welt nur – und bieten keinen Ansatz zur Besserung der gezeigten Verhältnisse. Also, irgendwer soll es richten. Es braucht eine Lösung. Durch Politik oder Religion oder auch Wissenschaft. Auch wenn das Festival open your eyes nur ein kleines Format im öffentlichen Raum des Zentrums der Stadt Zürich ist, trifft erstmals die Fähigkeit der Fotografie, die Welt zu beschreiben, auf den Nachweis der Wissenschaft, dass es Lösungen gibt. Das Zusammenwirken mit der ETH Zürich heisst nicht mehr und nicht weniger: «Leute, da draussen ist vieles nicht ganz gut. Aber wir wissen, wie wir es beheben können.» Weltklassewissenschaft trifft auf Weltklassefotografie. Und das ist etwas radikal Neues.
Um daran anzuschliessen: Als ich heute früh mit der S-Bahn in die Stadt gefahren bin, habe ich darüber nachgedacht, wie ich das beschreiben würde. Und dabei ist mir folgendes Bild in den Sinn gekommen: Die Fotografien, die dann in der Stadt zu sehen sein werden, sind eigentlich wie ein empathisches Lasso, mit dem ich die Leute einfange, die sonst einfach vorbeilaufen würden. Ich fange sie mit einem empathischen Lasso ein, habe sie plötzlich in der Hand, wenn auch vielleicht nur für Sekunden. Aber sonst hätte ich sie nicht, und schaffe es dann, bei einem Teil der Betrachter:innen über Empathie Bewusstsein für die Probleme auszulösen. Und vielleicht bleibt von diesem Gefühl etwas hängen – bis zu irgendeiner nächsten Abstimmung, wo es auch wieder um ein Klimagesetz geht oder irgendeine Abstimmung zu irgendeinem SDG relevanten Thema. Das ist für mich die Vision. Und noch etwas ist mir wichtig, weil Sie gesagt haben, es haben sich zwei getroffen, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Das sehe ich eigentlich anders. Ich habe eine Zeit lang Vorträge über Teilchenphysik fürs breite Publikum gehalten. Bei der Erklärung von Teilchenphysik kommt immer die Frage, wozu das alles gut ist. Okay, das ist die klassische Frage. Ich antworte dann, dass ich mich als Kulturschaffenden sehe. Da sind die Leute immer ein bisschen überrascht, dass ein Teilchenphysiker sagt, er sei ein Kulturschaffender. Das passt nicht. Von Kulturschaffenden haben wir ein ganz fixes Bild. Das ist jemand, der oder die Bildhauer:in ist oder malt oder Musik macht. Und ich sage, das stimmt nicht. Ich bin genauso ein Kulturschaffender wie Sie als Fotograf oder wie eine Musikerin. Warum? Weil es bei all diesen wissenschaftlichen und künstlerischen Aktivitäten letztendlich um das kreative Schaffen und Denken des Menschen geht. Und das kreative Schaffen und Denken des Menschen ist ein Pfeiler der menschlichen Kultur. Deswegen Kulturschaffender. Und deswegen führen wir hier nicht verschiedene Welten zusammen, sondern wir treten einfach gemeinsam auf.
Ich bin sehr überzeugt davon, dass Spitzenleistungen im Kreativen immer aus ein und derselben Wurzel wachsen, egal ob sie sich in wissenschaftlichen Thesen ausdrücken oder in der Kunst. Denn es gibt einen Umstand, der uns in die Hände spielt, weil es plötzlich ein Medium gibt, auf das sich die ganze Welt verständigt hat, und das ist das Bild – die Fotografie. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass es neben dem Wort eine zweite Kommunikationssäule gibt, die jetzt gerade wächst, die nicht nur Empathie transportieren kann und auch keine Sprache braucht. Die wahnsinnig schnell ist: Über das Auge mitten ins Herz – in Sekundenbruchteilen.
Durch diese Aussagen haben Sie gerade ein Bild bei mir im Kopf induziert, nämlich: Was hat den Turmbau zu Babel zu Fall gebracht? Plötzlich haben alle in verschiedenen Sprachen gesprochen – und das Ding ist kollabiert. Sie sagen, Fotografie ist die einzige universelle Sprache. Sie hilft uns sozusagen den Turmbau zu Babel, in dem wir uns befinden, vielleicht ein bisschen unter Kontrolle zu bringen.
Wir haben ja aus den Augen verloren, dass unser wichtigster Sinn der Gesichtssinn ist. Das Erfassen, das Erkennen der Welt geht nun mal zuerst über das Auge. Der ungarische Fotokünstler László Moholy-Nagy hat präzise auf den Punkt gebracht, worum es geht: «Die Fotografie ist dazu da, das Sichtbare sichtbar zu machen.» Eine endlose Abfolge von Erkenntnis, die uns so gar nicht bewusst ist. Genauso wie das die Wissenschaft macht, die auch das Sichtbare sichtbar macht. Wir haben in unseren Konzeptansatz zwei Begriffe eingeführt. Das ist der «concerned scientist» und der «concerned photographer», also Menschen, die, sagen wir mal ganz salopp, genauso wie jede:r andere auch, einem Erwerb nachgehen, um das Leben zu finanzieren. Aber darüber hinaus in einem gewissen Masse auch so etwas wie Einpersonen-NGOs sind. Die auf einer «mission» sind, die etwas dazu beitragen wollen, die Welt zu einem besseren Platz zu machen. Denn wir haben keine Wahl: Den Planeten B gibt es ja bekanntermassen nicht. David Doubilet, ein amerikanischer Unterwasser-Fotograf hat das kürzlich bei einer Rede sehr treffend auf den Punkt gebracht: «Die Welt trägt den falschen Namen, sie heisst Erde. Sie müsste aber Wasser heissen. Und wenn es dem Wasser schlecht geht, dann sind wir einfach nicht mehr da.» Was bedeuten in diesem Lichte die 17 SDGs für Sie ganz persönlich, für Günther Dissertori privat, als Person, als Persönlichkeit, als human being?
Aus dem Bauch heraus geantwortet, sind es für mich 17 Mahnmale. Für mich sind es Warnungen. Das ist es. Wenn ich im Auto unterwegs bin, und es kommt das Verkehrszeichen «Achtung Kreuzung» oder es kommt eine Hauswand oder ein Abgrund auf mich zu, dann kann ich darauf reagieren – oder auch nicht. Wenn ich nicht darauf reagiere, dann werde ich in den Abgrund fahren. Das ist mein tiefes Empfinden dieser SDGs. Ja, vielleicht negativ konnotiert, aber das ist mein persönliches Empfinden.
Sie sitzen ja am Steuer dieses Autos, Sie sind Rektor einer der wichtigsten Universitäten der Welt …
Ich bin nicht der Herr der Erde bzw. der Herr des Wassers.
Aber Sie sind der Fahrer eines sehr guten, sehr schnellen, sehr modernen Autos …
Nein, ich bin einer von denen, die in einem grossen Bus sitzen und der eine Landkarte in der Hand hält und sagt: Passt auf! Also jetzt müsstest du da rechts abbiegen und jetzt müsstest du da links abbiegen. Das, glaube ich, das sind wir!
Und wer sitzt am Steuer?
Ja, das ist die Frage. Am Steuer sitzen Menschen, die aus verschiedensten Gründen dort hingekommen sind und nicht unbedingt aus SDG getriebenen Gründen. Aber es sind nicht Wissenschafterinnen und Wissenschafter.
Wäre es nicht Zeit, dass wir wie beim Fliegen überlegen, ob wir überhaupt noch einen Piloten brauchen, ob vielleicht Technologie, also sprich Wissenschaft, nicht besser geeignet ist, um so ein Fahrzeug zu steuern?
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ich denke, möglicherweise wird am Ende die Rechnung der Natur einfach ohne den Faktor Mensch gemacht? Vielleicht ist der Mensch, als biologisches Wesen, einfach nicht in der Lage, diesen enormen evolutionären Schritt vom linearen zum exponentiellen Verhalten zu machen. Oder er würde für diese Entwicklung vielleicht viel mehr Zeit brauchen. Aber die haben wir nicht. Es wäre mein Wunsch, aber ich bin da sehr skeptisch, weil Teil der ganzen Komplexität die Tatsache ist, dass die Gemeinschaft der Menschen ein hochkomplexes System ist, mit all den zugehörigen sozialen Aspekten. Und ja, eigentlich muss man das grössere Ganze sehen. Allerdings tendiert die Gesellschaft eher dazu, sich zu polarisieren. Da ist die Wissenschaft. Und da ist die Gesellschaft. Die Wissenschaft müsste jetzt «nur» die Verantwortung übernehmen. Aber die Wissenschaft ist ja selbst Teil der Gesellschaft. Ich tue mir schwer, das zu trennen. Aber ja, man kann sich fragen, was würde passieren, wenn tatsächlich plötzlich auf irgendeinem Weg die Wissenschaft das Kommando übernehmen würde? Was würde dann passieren? Es sind immer nur noch Menschen. Oder wir machen den nächsten evolutionären Schritt und sagen, KI soll das Steuer übernehmen. Dabei sehe ich aber eine Problematik: KI wird auf Daten trainiert. Aber die Daten, die zurzeit zur Verfügung stehen, sind von Menschen generiert…
Das alles klingt jetzt sehr dystopisch. Ich habe ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, menschliches Verhalten ändert sich anscheinend leider nur durch Disruption. Aber vielleicht braucht es einfach diese brutale Disruption. Teil der Evolution ist es, dass es einfach immer wieder brutale Disruptionen gegeben hat. Also früher oder später gibt es sowieso eine Disruption, nämlich dann, wenn die Sonne sich aufbläht und alles auf der Erdoberfläche zerstört. Dann ist hier sowieso Ende Gelände. Ich hoffe, Sie können trotzdem schlafen heute Nacht.
Aber bis dahin ist ja noch Zeit.
Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Jetzt muss ich zurückkommen zum Beginn unseres Gespräches. Sie haben ja am CMS-Experiment zur Pikosekunde nach dem Urknall geforscht, also ganz knapp nach der Entstehung der Welt. Jetzt haben Sie das Ende der Welt, also nicht das Ende des Universums, sondern das Ende unserer Welt skizziert. Was passiert mit dem Homo sapiens?
Da habe ich eine Vorstellung dazu. Ich glaube, wir überschätzen uns hoffnungslos. Im Sinne von, was man im Universum sieht: Alles entsteht und vergeht, sogar Sterne. Alles entsteht und vergeht, aber der Homo sapiens hat – vielleicht ist das Teil des sapiens – die Einstellung entwickelt: «Ich stehe drüber, ich darf, ich kann gar nicht vergehen.» Und das ist diese maximale Überschätzung. Ich finde, der Homo sapiens ist zwar eine unglaublich faszinierende, sehr komplexe Entwicklung, hier lokal im Universum aus den Naturgesetzen heraus. Aber wer sagt uns, dass dies das Maximum ist. Es gibt so viele Möglichkeiten im Universum für ähnliche Entwicklungen. Warum denken wir, wir sind das Ultimative? Ganze Sterne vergehen und dann werden wir hier auch mal vergehen. Vielleicht entsteht irgendwo anders etwas Ähnliches oder etwas noch Faszinierenderes. Deshalb bin ich gelassen. Diese Gelassenheit ist geprägt durch das Gefühl: Immerhin habe ich für ein paar Jahre diese Sekunde in der Geschichte des Universums miterlebt. Das sehe ich als Privileg – und damit bin ich zufrieden.
Das Gespräch mit Prof. Dr. Günther Dissertori fand am 23. Juni 2023 im Rektorat der ETH Zürich statt. Geführt hat es Lois Lammerhuber.
